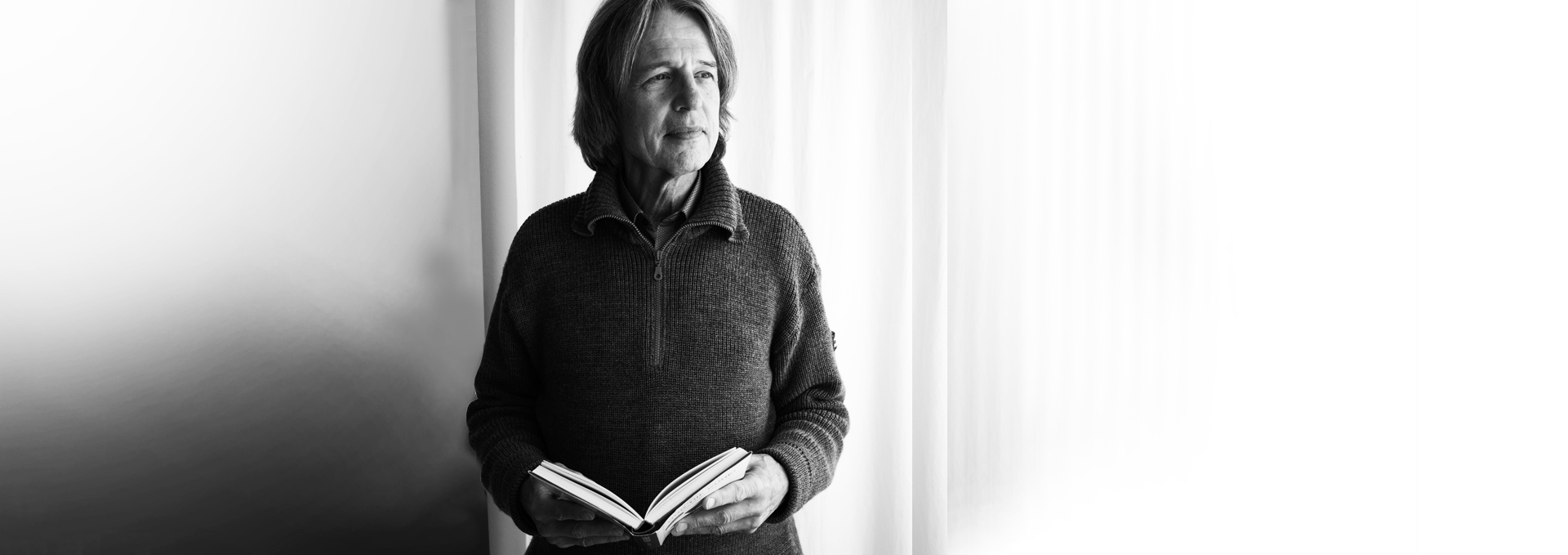- PHILOSOPHIE TO GO -
DIE TÄGLICHEN
“WORTE DER WEISHEIT”
Es gibt eine Art von Versenkung, die durch Glaube, Mut, Erinnerung, Sammlung und Weisheit erreicht wird.
Das Zitat ist ein Yoga-Sutra des Patañjali. Er unterscheidet drei Arten der tiefen Meditation („Versenkung”) durch Yoga: die durch logisches Denken und prüfende Überlegung (lat. meditor = nachdenken), die durch Übung und schließlich die im Zitat genannte. Diese scheint eine Art zu sein, die weniger durch klassische Meditation als vielmehr durch eine weise Lebensführung erreicht wird. Die altindischen Upanishaden, in denen viel vom Yoga die Rede ist, kennen eine „Zwei-Wege-Lehre”. Danach kann der Mensch Glück und Erfüllung entweder durch konsequenten Weltverzicht erreichen (wie die Yogis) oder durch ein Leben in der Gemeinschaft mit Beruf, Ehe und Familie, wenn man dabei der Philosophie und Lehre der Veden folgt (der „Vaterweg”). An diese Auffassung scheint das Zitat anzuknüpfen. Dogmatismus ist der antiken Weisheitslehre in Ost und West fremd. Es ist ein Ausdruck menschlicher Freiheit, dass jeder Einzelne aufgefordert ist, seinen eigenen Weg im Leben zu finden. Die Weisheitslehre gibt wesentliche Orientierung, gibt aber im Einzelnen Raum für eine eigenverantwortliche Lebensgestaltung. Welcher Weg zu wählen ist, hängt von der Zeit, den Umständen und der Individualität des Einzelnen ab.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Liebe Freunde/innen der Weisheit,
in unserem Philosophie-Podcast „Der Pudel und der Kern“ ist eine neue Folge #110 zu hören. Es geht um den "Kairos", wie die alten Griechen den "richtigen Augenblick" für etwas bezeichneten. Alles hat seine Zeit.

"Wer die Zeit trifft, dem gelingt es; wer die Zeit verfehlt, der kommt ins Verderben."
Liezi
Den kostenfreien Podcast und die wichtigsten Informationen dazu finden Sie auf der Website: www.pudel-kern.com
Ferner auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, u.a.:
https://open.spotify.com/episode/3m4MY2ORYhru8h3jiVmR1k
Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn bitte weiter. Über Anmerkungen und Rückfragen freuen wir uns.
________________________________________________
Philosophische Matinee im Web:
Sonntag, den 28. Juli 2024, 10-12 Uhr: "Buddha"
Die Zugangsdaten lauten:
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/83414909092?pwd=nZoztS3maa5pA0r3Rvd3kQQfcwg5qk.1
Meeting-ID: 834 1490 9092
Kenncode: 369548
Anstelle einer Teilnahmegebühr ist eine Spende willkommen. Da „Maß und Mitte“ ein gemeinnütziger Verein ist, kann die Spende steuerlich abgesetzt werden. Zur steuerrechtlichen Anerkennung reicht der Überweisungsbeleg. Das Spendenkonto lautet:
MASS UND MITTE
Münchner Bank eG
IBAN: DE58 7019 0000 0002 5719 35
BIC: GENODEF1M01
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden nicht mehr als 25 Teilnehmer zugelassen. Die Texte, die wir besprechen wollen, finden Sie im Anhang (1 Seite).
______
Für Kurzentschlossene!
Es sind noch Plätze frei:
Philosophie und Malen – Kunst und gutes Leben
Seminar im „Haus der Weisheit“, Reit im Winkl, vom 05.-10. August 2024
Mit dem Maler Max Fischer und Albert Kitzler.
Morgens Malen, nachmittags Philosophieren. Es sind weder Vorkenntnisse in Philosophie noch praktische Erfahrungen im Malen erforderlich. Max wird der Kreativität, die jeder hat, den notwendigen Anstoß geben sowie Anleitungen zur Entfaltung der eigenen Ideen. Die Veranstaltung wird zum dritten Mal durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden ersten Seminare waren sehr beeindruckend.
"Jeder Mensch ist ein Künstler", Joseph Beuys
Dauer: Montag, 15:00 h, bis Samstag, 12:30
Seminargebühr: 590,- €
Leinwände, Staffeleien, Pinsel, Farben etc. (werden gestellt): 85,- € pro TN
Unterkunft buchen TN selbständig
Touristinformation: https://www.reitimwinkl.de, Tel. 08640 80020
Anmeldung: Per E-Mail an massundmitte@gmx.de oder Anmeldeformular im Anhang
Mehr zu der Veranstaltung hier.
Ich würde mich freuen, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße
Ihr
Albert Kitzler
Weisheit, Menschlichkeit, Mut: diese drei sind die immer wirksamen Kräfte auf Erden.
Die Stelle stammt aus dem chinesischen „Buch der Riten, Sitten und Gebräuche” und lautet vollständig:
„‘Weisheit, Menschlichkeit, Mut: diese drei sind die immer wirksamen Geisteskräfte auf Erden. ... Liebe zum Lernen führt hin zur Weisheit, kräftiges Handeln führt hin zur Menschlichkeit, sich schämen können führt hin zum Mut. Wer diese drei Dinge weiß, der weiß, wodurch er seine Person zu bilden hat. Wer weiß, wodurch er seine Person zu bilden hat, der weiß, wodurch er die Menschen ordnen kann. Wer weiß, wodurch er die Menschen ordnen kann, der weiß, wodurch er die Welt, den Staat, das Haus ordnen kann.’”
Mut, für sich und seine Werte einzustehen, setzt voraus, sie so zu verinnerlichen, dass man sich selbst Vorwürfe machen würde („sich schämen“ würde), wenn man im Alltag von ihnen abweichen wollte.
Es ist eine der wesentlichen Einsichten des Konfuzianismus, dass jede nachhaltige Umgestaltung und Verbesserung der gesellschaftlichen Verhältnisse von dem einzelnen Menschen auszugehen hat. Wer im Innern wächst und sich positiv weiterentwickelt, vom dem geht ein Impuls auf die Gesellschaft aus, sei es auch nur auf seine unmittelbare Umgebung. Von dieser ausgehend zieht er aber immer weitere Kreise. Alles hängt mit allem zusammen. Alles hat eine Wirkung.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Lerne, tapfer das Schicksal zu ertragen.
Das ist eine Quintessenz folgender bemerkenswerter Stelle bei dem griechischen Dichter Archilochos (7. Jh. v. Chr.). Er gilt als einer der ersten griechischen Lyriker.
„Herz, mein Herz, zerwühlt von Schmerzen, die kein Mittel mehr dir bannt,
Raff' dich und steh dem Schicksal, stemm‘ entgegen ihm die Brust,
Dicht vor deiner Feinde Tücken pflanze dich gepanzert auf!
Wenn du Sieg gewonnen, jauchze nicht vor aller Welt es aus,
Und verlorst du, winsle nicht zu Haus und wirf dich in den Staub!
Weder freu dich in der Freude, noch zergräme dich im Leid
übermäßig und vergiss nicht, welchen Takt das Leben hält!”
Ein Aufruf, den Anfeindungen und Widrigkeiten des Lebens tapfer entgegenzutreten und extreme Gefühle wie „himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt“ zu meiden. Demokrit, der derselben Meinung war, wird später zur Begründung sagen, dass eine Seele, die von heftigen Gefühlen hin- und hergerissen wird, weder gefestigt noch ruhig oder wohlgemut ist. Um die innere Ruhe zu bewahren, empfiehlt Archilochos, dass man sich immer wieder bewusst machen soll, dass sich im Lauf des Lebens Freude und Leid notwendig abwechseln. „Erkenn‘ den Rhythmus, der im Menschenleben herrscht”, lautet eine andere Übersetzung der letzten Zeile. „Feind” kann in einem weiten Sinn verstanden werden als alles Innere und Äußere, was ein friedliches und glückliches Leben bedroht.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Man übe Yoga mit frohem Mut und äußerster Entschlossenheit.
Das ist der Sinn folgender Stelle aus der indischen Bhagavadgita:
„Das nennt den wahren Yoga man,
Der aus des Schmerzes Haft befreit,
Den übe man mit frohem Mut
In äußerster Entschlossenheit.”
„Befreiung aus des Schmerzes Haft” bedeutet „Loslösung vom Leidenskomplex”, der nach indischer Auffassung mit einem gewöhnlichen ich-zentrierten und weltverhafteten Leben notwendig verbunden ist. Dieser Gedanke wurde zentral für die Philosophie Buddhas.
Wie jede Lebensweisheit erfordert Yoga immer wieder Selbstüberwindung, d.h. Ausdauer, einen festen Willen und Mut, sich gegen innere und äußeren Widerstände und gegen das eigene Ego durchzusetzen. Je nachlässiger wir darin sind, umso mehr entfernen wir uns von einer weisen Lebensführung und dem, was uns guttut. Zwar gehört zur Weisheit neben dem Ernst auch eine Leichtigkeit des Seins. Aber Leichtigkeit bedeutet nicht Nachlassen oder Aufgabe einer besonnenen, beharrlichen und tapferen Selbststeuerung.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Zur Lebensweisheit gehört, dass der Mensch standhaft bei dem verharrt, was er für richtig erkannt hat.
Dieser Sinn ist in folgenden Worten des Konfuzius enthalten:
„Ein Mensch, der standhaft ist (Tapferkeit), den Entschlossenheit und Einfachheit auszeichnen und der darüber hinaus seine Worte mit Überlegung wählt - der kommt wahrer Sittlichkeit (Weisheit) nahe.”
Wenn Konfuzius von „Sittlichkeit” spricht, dann meint er damit überlieferte Lebensweisheit, gelebte gute Gewohnheiten, die zu Riten verinnerlicht wurden, nicht aber die in einer Gesellschaft herrschenden Vorstellungen und Konventionen vom richtigen Umgang miteinander. Diese können gute Gewohnheiten sein, müssen es aber nicht. Mut, Entschlossenheit und Einfachheit gehören zu einer weisen Lebensführung. Wer nicht die Kraft aufbringt, seiner Einsicht auch gegen innere oder äußere Widerstände zu folgen, der hat das Steuer seines Lebens aus der Hand gegeben.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Tapfer ist nicht nur, wer über seine Feinde, sondern auch wer über seine grenzenlosen Lüste siegt.
Das Zitat stammt von dem griechischen Philosophen Demokrit. Es folgt der Zusatz: „Manche freilich herrschen über Städte und sind [doch] Knechte ihrer Frauen!” Dies ist nicht gegen die Frauen gerichtet, sondern eine frühe Bestätigung ihrer Bedeutung im alltäglichen Leben. Gemeint ist, dass auch mächtige Menschen häufig Sklaven ihrer sinnlichen Begierden sind und sie nicht zu zügeln verstehen. Im Äußeren überwinden sie vieles, im Inneren aber versagen sie und sind nicht „Herr im eigenen Haus“. Gegen andere sind sie stark, gegen sich selbst schwach. Auf den Schlachtfeldern feiern sie Siege, in der eigenen Seele überwiegen die Niederlagen. Die Tapferkeit, eine der vier griechischen Haupttugenden, hat ihren festen Platz in der antiken Weisheitslehre: Zu einem weisen Leben gehören Kraft, Mut, Ausdauer und Entschlossenheit, die ungezügelten Begierden und eigenen inneren Widerstände gegen eine selbstbestimmte Lebensführung immer wieder zu überwinden.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Liebe Freunde/innen der Weisheit,
unsere nächste philosophische Matinee im Web findet statt am:
Sonntag, den 28. Juli 2024, 10-12 Uhr: "Buddha"
Die Zugangsdaten lauten:
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/83414909092?pwd=nZoztS3maa5pA0r3Rvd3kQQfcwg5qk.1
Meeting-ID: 834 1490 9092
Kenncode: 369548
Anstelle einer Teilnahmegebühr ist eine Spende willkommen. Da „Maß und Mitte“ ein gemeinnütziger Verein ist, kann die Spende steuerlich abgesetzt werden. Zur steuerrechtlichen Anerkennung reicht der Überweisungsbeleg. Das Spendenkonto lautet:
MASS UND MITTE
Münchner Bank eG
IBAN: DE58 7019 0000 0002 5719 35
BIC: GENODEF1M01
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden nicht mehr als 25 Teilnehmer zugelassen. Die Texte, die wir besprechen wollen, werden zwei Wochen vor dem Termin über den Newsletter zur Verfügung gestellt.
______
Für Kurzentschlossene!
Es sind noch Plätze frei:
Philosophie und Malen – Kunst und gutes Leben
Seminar im „Haus der Weisheit“, Reit im Winkl, vom 05.-10. August 2024
Mit dem Maler Max Fischer und Albert Kitzler.
Morgens Malen, nachmittags Philosophieren. Es sind weder Vorkenntnisse noch praktische Erfahrungen im Malen erforderlich. Max wird der in jedem vorhandene Kreativität den notwendigen Anstoß geben sowie Anleitungen zur Entfaltung der eigenen Ideen. Die Veranstaltung wird zum dritten Mal durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden ersten Seminare waren sehr beeindruckend.
"Jeder Mensch ist ein Künstler", Joseph Beuys
Dauer: Montag, 15:00 h, bis Samstag, 12:30
Seminargebühr: 590,- €
Leinwände, Staffeleien, Pinsel, Farben etc. (werden gestellt): 85,- € pro TN
Unterkunft buchen TN selbständig
Touristinformation: https://www.reitimwinkl.de, Tel. 08640 80020
Anmeldung: Per E-Mail an massundmitte@gmx.de oder Anmeldeformular im Anhang
Mehr zu der Veranstaltung hier.
Ich würde mich freuen, Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Herzliche Grüße
Ihr
Albert Kitzler
Menschlichkeit und Güte befreien von Sorgen.
Dieser Sinn kann folgender Stelle bei Konfuzius entnommen werden:
„Zum Weg des Weisen gehört dreierlei, aber ich bewältige es nicht:
Richtiges Verhalten zu anderen Menschen – es befreit von Sorgen.
Weisheit – sie bewahrt vor Zweifeln.
Entschlossenheit – sie überwindet die Furcht.“
Was hier mit „richtigem Verhalten“ übersetzt wird, ist das chinesische Zeichen für „ren“ („jen“). Für Konfuzius ist der Begriff grundlegend, aber auch sehr komplex. Er wird meistens übersetzt mit „Menschlichkeit“ oder „Güte“ und umfasst Bedeutungselemente von Humanität, Menschenliebe, Verständnis, Freundlichkeit, Warmherzigkeit. Auffällig in dem Zitat ist die Selbstkritik und Bescheidenheit des großen Meisters, der eingesteht, dass er selbst vollkommene Weisheit noch nicht erreicht hat
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Sich selbst recht machen ist alles. Dann ist man frei von Sorgen.
Das ist der Sinn folgender Stelle bei dem chinesischen Philosophen Zhuangzi:
„Sich selbst recht machen ist alles. Höchste Freude ist es, das Ziel zu erreichen … Was von außen her der Zufall bringt, ist nur vorübergehend. Das Vorübergehende soll man nicht abweisen, wenn es kommt, und nicht festhalten, wenn es geht. … Dann ist unsere Freude dieselbe im Glück und Unglück, und man ist frei von allen Sorgen. Heutzutage aber verlieren die Leute ihre Freude, wenn das Vorübergehende sie verlässt. Von diesem Gesichtspunkt aus sind sie auch mitten in ihrer Freude immer in Unruhe …“
Die Sorgenfreiheit wird hier mit der Konzentration auf die persönliche Entwicklung und die Herstellung inneren Seelenfriedens in Verbindung gebracht. Auf diese Weise wird unsere Seelenverfassung von den äußeren Umständen und dem Gang der Dinge unabhängig. Wenn man mit sich im Reinen ist, führt dies zur Sorgenfreiheit, denn die Sorgen knüpfen überwiegend an Hoffnungen, Wünsche und Befürchtungen an, die auf äußere Dinge und Umstände bezogen sind.
____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Wer sich wegen einer ernsten oder geringfügigen Sache Sorgen macht, ist nicht glücklich, sondern unglücklich.
Das Zitat stammt aus dem sog. „Gnomologium Vaticanum“, einer Sammlung antiker Sprüche, die im 19. Jahrhundert im Vatikan gefunden wurde. Es lautet vollständig:
„Die wahre Lust besteht darin, dass die Seele sich in einem Zustand der Ruhe und der Heiterkeit befindet. Ohne das sind die Schätze von Midas und Kroisos nutzlos. Wer sich wegen einer ernsten oder geringfügigen Sache Sorgen macht, ist nicht glücklich, sondern unglücklich.“
Midas und Kroisos waren teils mythische (Midas), teils historische (Kroisos) Könige der Antike, die wegen ihres großen Reichtums berühmt waren. Dem Midas erfüllte der Gott seinen Wunsch, dass alles zu Gold werde, was er anfasse. Als er daraufhin drohte zu verhungern und zu verdursten, bat er händeringend den Gott, seine Gabe wieder zurückzunehmen. Die innere Ruhe und Heiterkeit der Seele kann vielleicht als das letzte Ziel aller antiken Weisheitslehren im Westen wie im Osten angesehen werden. Auch der heutige Mensch dürfte sich nach nichts mehr sehnen als nach innerer Ausgeglichenheit, Seelenfrieden und einem anhaltenden Zustand heiterer Gelassenheit.
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Was kann die Sorgen mindern?
Folgende Empfehlung gibt der römische Dichter Horaz:
„Bei allem Tun und Treiben lies die Lehrer der Weisheit und befrage sie nach dem Leitsatz, der dein Leben in ruhiger Fahrt dahinführen kann. Prüfe, ob dich ein ewig unbefriedigtes Begehren hetzt und plagt, ob es die Pein der Unruhe (pavor = Angst) ist oder das Hoffen auf Güter, deren Wert gering ist. Suche Antwort auf die Fragen: … Was kann die Sorgen mindern, was bringt dich mit dir selbst in Einklang und schafft dir heitere Ruhe? Etwa Ehre gewinnen? Hübsch Geld verdienen? Oder tut es die Abkehr von der Heerstraße, ein Lebenspfad in den Bergen der Stille?“
Mit „Heerstraße“ ist der Lebensweg der Menge gemeint. Horaz deutet an, dass die Sorgenfreiheit am ehesten in dem harmonischen Einklang mit sich selbst zu finden ist (Authentizität), eine im antiken Weisheitsdenken weit verbreitete Meinung. Denn damit löst man sich von den Zufälligkeiten äußerer Umstände wie etwa der Gewinn von Ehre oder Geld.
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Der Weise kennt weder Sorge noch Furcht.
Der Ausspruch stammt von Konfuzius. Das Zitat lautet vollständig:
„Si-ma Niu (ein Schüler) fragte, was einen Weisen kennzeichne. ‚Der Weise kennt weder Sorge noch Furcht’, sprach der Meister.
Si-ma Niu sagte: ‚Wer ohne Sorge und Furcht ist, den nennt man einen Weisen?’
Der Meister antwortete mit einer Gegenfrage: ‚Wenn einer sich selbst prüft und dabei nichts Böses entdeckt – warum sollte er da in Angst und Sorge leben?“
Bemerkenswert ist hier die Verbindung von Sorgenfreiheit, Selbsterkenntnis und innere Stimmigkeit. Für Konfuzius setzt das Verschwinden des Bösen in einer Person kontinuierliche Selbsterziehung voraus, d.h. dass sich der Mensch durch ständige Übung konsequent seiner Fehler und Charakterdefizite entledigt oder sie doch so beherrscht, dass sie weder anderen noch sich selbst Schaden zufügen. Das Ergebnis ist innere Einheit. Die eigenen Werte stimmen mit dem Denken, Wollen und Handeln überein und werden im täglichen Leben umgesetzt. Dem Weisen gelingt es. Da diese Authentizität das Wichtigste im Leben ist, verliert alles Äußere an Bedeutung. Damit verschwinden auch die Sorge und viele andere Quälgeister der Seele, die aus einer starken Bindung und Fixierung auf Äußerliches erwachsen.
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Lass die Sorge nicht überhand nehmen, damit du nicht verstört wirst.
Das Zitat stammt aus dem alten Ägypten (3. Jahrtausend vor Chr.) und lautet im Zusammenhang:
„Wenn das Herz um seinen Besitzer (zu sehr) besorgt ist, dann schafft es ihm Krankheit.
Wenn (zu große) Sorge aufkommt, sucht das Herz selbst seinen Tod.
Gott ist es, der dem Weisen Geduld verleiht im Unglück.
Der Gottlose, der Gott vergessen hat, stirbt an Herzenstrübsal.
Eine kurze Zeit des Unglücks ist im Herzen des Ungeduldigen wie eine lange Zeit.“
Das Herz war bei den alten Ägyptern nicht nur Sitz der Emotionen, sondern vor allem auch der Vernunft, der Einsicht und somit das Organ, das die Lebensführung des Menschen steuert. Darin drückt sich die Erkenntnis aus, dass Denken und Fühlen eng miteinander verbunden sind und sich ständig gegenseitig beeinflussen. Der letzte Satz besagt, dass wer Unglück oder schwierige und bedrückende Lebensphasen nicht geduldig aushalten kann, sein Leid und die seelisch-körperliche Belastung nur vergrößert und damit die Gefahr ernsthafter Erkrankungen heraufbeschwört. Wir können Schicksalsschlägen nicht ausweichen, aber wir können lernen, sie tapfer zu ertragen, zu überwinden und unsere Lebensfreude zurückzugewinnen. „Es ist ein großes Unglück, Unglück nicht ertragen zu können“, sagte der griechische Philosoph Bion von Borysthenes.
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Denn Geschäfte, Sorgen, Zorn und Gunst stimmen nicht überein mit der Glückseligkeit.
Das antike Weisheitsdenken in West und Ost hatte unsere Lebensführung zum Gegenstand. Was kann der Mensch tun, damit sein Leben einen angenehmen, glücklichen und erfüllten Verlauf nehme? Ausgangspunkt dieses Denkens war stets ein Unbehagen an gewissen Aspekten des Lebens und die Frage, wie man mit diesen Aspekten umgehen soll, damit aus dem Unbehagen ein Wohlbehagen werde. Wie geht man mit dem Leiden um? Kann man es überwinden, reduzieren oder gar in Freude verwandeln? Eines dieser Leiden war die Sorge; nicht das positive „Umsorgen“, sondern jene Sorge, die wir als belastend empfinden und die Ängste hervorruft. Wie in dem obigen Zitat des griechischen Philosophen Epikur wurde die Sorge häufig auf ein übermäßiges Geschäftemachen, eine einseitige Ausrichtung auf materielle Dinge oder eine Abhängigkeit von anderen Menschen zurückgeführt. Das Zitat lautet vollständig:
„Denn Geschäfte, Sorgen, Zorn und Gunst stimmen nicht überein mit der Glückseligkeit, sondern zeigen Schwäche, Furcht und Abhängigkeit vom Nächsten.“
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Der Philosoph fragt nach der Ganzheit und nach dem, was dem Menschen eigentümlich ist.
So können wir Platons Verständnis der Philosophie zusammenfassen, wenn er den Sokrates sagen lässt:
„Wir wollen denn also, scheint es, da es dir recht ist, über die echten Philosophen sprechen. Sie kennen von Jugend auf nicht den Weg zum Markt und wissen nicht, wo Gericht oder Rathaus oder sonst eine Behörde der Stadt ist ... Der Philosoph weiß von alldem nicht einmal, dass er es nicht weiß. Denn er hält sich nicht fern davon, weil es für fein gilt, sondern wirklich ist nur sein Körper in der Stadt und zu Haus; sein Geist aber, dem dies alles klein und nichtig ist, verachtet das; der fliegt, wie Pindar sagt, über die Erde hin (Vogelperspektive) und vermißt ihre Flächen (von veremessen), und über den Himmel hinaus und treibt Astronomie und forscht überall nach allem Wesen der Dinge in seiner Ganzheit, ohne sich auf die Dinge in der Nähe niederzulassen. ... Aber was der Mensch ist, und was seinem Wesen eigentümlich ist, im Tun und Leiden, danach fragt er und das zu erforschen bemüht er sich.“
Der Philosoph kümmert sich nach Platon wenig um materielle Güter und die weltlichen Geschäfte, sondern versucht, sich selbst und das Ganze, das Allgemeine und Bleibende in allem, zu verstehen. Wegen dieser philosophischen Sicht auf die Dinge, die von der Sichtweise der Mehrzahl der Menschen abweicht, bezeichnet Platon den Philosophen an anderer Stelle ironisch als „verrückt“, sprich: herausgerückt aus der Denkweise der Masse. Im Leben ist es sehr hilfreich, immer wieder die Perspektive auf die Dinge zu ändern.
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Wer dem Großen in sich folgt, wird groß; wer dem Kleinen in sich folgt, wird klein.
Worte des chinesischen Philosophen Menzius. Als er dies sagte, wurde er gefragt:
„Es sind doch alle in gleicher Weise Menschen. Wie kommt es, dass manche dem Großen in sich folgen und manche dem Kleinen?“ Menzius antwortete: „Die Sinne des Gehörs und Gesichts werden ohne das Denken von dem Sinnlichen umnachtet. Wenn Sinnliches außer ihm auf Sinnliches in ihm trifft, so wird der Mensch einfach mitgerissen. Das Gemüt ist der Sitz des Denkens. Wenn es denkt, so erfüllt es seine Aufgabe, wenn es nicht denkt, so erfüllt es sie nicht.“
Ein Hohelied auf die Philosophie, denn ihr Gegenstand ist das Denken. Dieses sei imstande, uns davon abzuhalten, dass wir uns ungezügelt den sinnlichen Genüssen hingeben und uns dabei verlieren. Das Denken ist das „Große“, von dem Menzius spricht, und das nach seiner Meinung die Bestimmung des Menschen ausmacht, „seine Aufgabe“ ist. Aristoteles war derselben Meinung. Nur im denkenden Erkennen könne der Mensch Glückseligkeit erlangen, weil er nur darin seine Bestimmung (griechisch: telos) erfüllt.
_____
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Einfach und bescheiden ist das Werk der Philosophie; verführe mich nicht zu prahlerischem Schein!
Der Ausspruch stammt von dem Philosophenkaiser Marc Aurel. Philosophie ist das Streben nach Weisheit, nicht ihr Besitz. Der Philosoph weiß, dass er vieles nicht weiß. Das macht ihn bescheiden und weiser als andere, die sich einbilden, vieles zu wissen und dadurch das wenige Wissen, das sie vielleicht haben mögen, mit vielen Irrtümern verderben. Der Weise hält sich fern von jeder Überheblichkeit (Hybris). Er bleibt im Stand der Frage, des produktiven Zweifelns. Er ist aufgeschlossen, offen, interessiert und aufmerksam, aber immer auch kritisch, vor allem sich selbst und seinem vermeintlichen Wissen gegenüber. Er handelt danach, was er im Augenblick für das Vernünftigste hält. Ob aber sein Fragen ihn nicht schon morgen eines Besseren belehrt, das weiß er nicht.
______
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Die Wahrheit haben ist göttlich, nach Wahrheit streben ist menschlich.
Das Zitat stammt von dem chinesischen Philosophen Menzius. „Nach Wahrheit streben“ ist nichts anderes als philosophieren, denn „Philosophie“ bedeutet: „Liebe zur Weisheit“. Zur Weisheit aber gehört die Wahrheit. Das Zitat lautet im Zusammenhang:
„Mit den Nächsten in Eintracht zu leben gibt es nur einen Weg: - wer beim Insichgehen nicht wahr ist, der kann nicht mit seinen Nächsten in Eintracht leben. Sein Leben wahr zu machen gibt’s nur einen Weg: - Wer sich nicht klar ist über das Gute, der kann nicht wahr werden in seinem Leben. Darum: Die Wahrheit haben ist göttlich, nach Wahrheit streben ist menschlich. Wer wahr ist, wird immer Eindruck machen. Aber ein Unwahrhaftiger ist noch nie imstande gewesen, Eindruck zu machen.“
Die Rede ist hier von der Erkenntnis des eigenen Selbst und des guten Lebens. Charakteristisch für das altchinesische Denken ist die Auffassung, dass derjenige, der „wahr“ ist - wir würden heute sagen: der authentisch, wahrhaftig, in sich stimmig ist -, schon durch seine bloße Erscheinung und durch sein Zusammenleben mit anderen wirkt und Einfluss ausübt („Eindruck machen“). Denn seine innere Reife bleibt den Mitmenschen nicht verborgen.
______
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.X
Leer ist die Rede eines Philosophen, durch die keine menschliche Leidenschaft geheilt wird.
Das Zitat stammt von dem griechischen Philosophen Epikur. Es heißt weiter:
„Wie nämlich die Medizin nichts nützt, wenn sie nicht Krankheiten aus dem Körper vertreibt, so nützt auch die Philosophie nichts, wenn sie nicht die Leidenschaft aus der Seele vertreibt.“
Philosophie wird hier, wie häufig in der Antike, als Seelenheilkunde verstanden. Für die Griechen, die Meister von Maß und Mitte, waren ungezügelte, maßlose Leidenschaften - und nur von diesen ist hier die Rede - etwas Furchterregendes und das Gegenteil von Weisheit. Wir verlieren die Selbstkontrolle und Selbststeuerungskräfte und damit unsere Freiheit zu eigenverantwortlicher Lebensführung. Das griechische Wort für Leidenschaft (páthos) steht daher deutlich näher dem Leiden und entbehrt jene positive Bedeutung, die dem deutschen Wort „Leidenschaft“ seit der Romantik zukommt. Bei den Griechen und im Kontext von Übersetzungen antiker Weisheitsschriften bezeichnet „Leidenschaft“ ausschließlich ein schädliches Übermaß an Emotionalität und Begehren.
______
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen
Man muss die Namen richtigstellen, korrekt denken und danach handeln.
Das Zitat stammt von Konfuzius. Eingefordert werden ein philosophisches Denken und eine Lebensführung, die sich danach richtet. Denn was ist die „Richtigstellung der Namen“ anderes als Erhellung des Denkens, der Sprache, der Begriffe, damit wir die Dinge angemessen erkennen und beschreiben können und die Welt verstehen, wie sie ist, nicht wie wir sie uns wünschen oder vorstellen? Philosophie sucht die Wahrheit hinter dem Schein, das Bleibende und Gültige. Erst dann können wir so mit uns und der Welt umgehen, dass wir Freude an unserem Leben haben. Das Zitat lautet im Zusammenhang:
„(Der Schüler) Zi-lu sprach zu Konfuzius: ‚Wenn Euch der Herrscher des Staates We die Regierung anvertraute – was würdet Ihr zuerst tun?’ Der Meister antwortete: ‚Unbedingt die Namen richtigstellen. … Stimmen die Namen und Begriffe nicht, so ist die Sprache konfus. Ist die Sprache konfus, so entstehen Unordnung und Misserfolg. Gibt es Unordnung und Misserfolg, so geraten Anstand und gute Sitten in Verfall. Sind Anstand und gute Sitten in Frage gestellt, so gibt es keine gerechten Strafen mehr. Gibt es keine gerechten Strafen mehr, so weiß das Volk nicht, was es tun und was es lassen soll. Darum muss der Weise (Edle) die Begriffe und Namen korrekt benutzen und auch richtig danach handeln können. Er geht mit seinen Worten niemals leichtfertig um.’“
_______
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.
Denn von Natur, mein Freund, liegt in seiner Seele ein gewisser philosophischer Zug.
Was Platon hier über den Redner Isokrates sagt (nicht zu verwechseln mit seinem Lehrer Sokrates), gilt für jeden Menschen. So dürfte Platon dies auch gemeint haben. Wir alle streben nach einem ganzheitlichen Verständnis von uns selbst und der Welt, nach Kohärenz, Konsistenz und innerer Stimmigkeit unseres Weltverstehens, nach Zusammenhang in unserem Denken, Wollen, Fühlen und Handeln, kurz: nach einem philosophischen Standpunkt, der größere Zusammenhänge schafft und überblickt. Sokrates beschließt den Dialog, aus dem das Zitat stammt, mit folgenden bedeutungsvollen Sätzen, die nicht direkt etwas mit dem Vorstehenden zu tun haben:
„Lieber Pan du, und alle ihr anderen Gottheiten dieser Stätte, möchtet ihr mir verleihen schön zu werden im Innern; und dass all mein äußerer Besitz den inneren Eigenschaften nicht widerstreitet. Reich möge mir dünken, wer weise ist. An Goldes Last möge mir soviel zuteilwerden als nur eben der Verständige zu heben und zu tragen vermöchte. Bedürfen wir sonst noch einer Sache, mein Phaidros? Für mich ist damit ein volles Maß erbeten. (Phaidros): Schließe mich ein in dein Gebet. Denn gemeinsam ist was Freunden gehört.“
________
Die "Worte der Weisheit" erscheinen seit über dreizehn Jahren jeden Morgen.